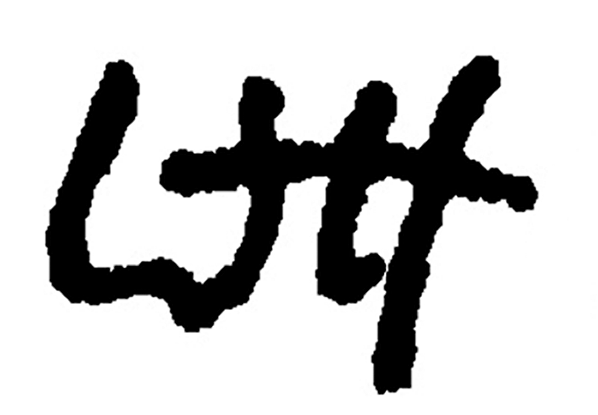Zeitasche oder Wie wir der Dinge habhaft werden. Wolfgang Hilbig schreibt eine mittelalterliche Erzählung um.
von Frieder von Ammon
Einer der faszinierendsten zugleich und rätselhaftesten Texte Wolfgang Hilbigs ist die kurze, kaum mehr als zwei Seiten lange Erzählung Glasasche, die zuerst 1983 in dem Band Stimme Stimme veröffentlicht wurde. Niemand scheint sich bisher über diesen Text gewundert zu haben – obwohl er allen Anlass dazu bietet: Wie, so müsste man sich etwa fragen, wäre eigentlich sein Thema anzugeben? Warum ist er in einem so seltsam uneinheitlichen Stil gehalten? Wie könnte man seinen Titel und wie den änigmatischen Schluss deuten? Auf Anhieb lässt sich jedoch keine dieser Fragen zufriedenstellend beantworten.
Immerhin hat Hilbig – untypisch für ihn – im Untertitel seiner Erzählung eine Spur gelegt: Gesta Romanorum No. 46. Was hat es damit auf sich? Der Untertitel verweist auf einen vorgängigen Text, Hilbig markiert auf diese Weise also eine intertextuelle Bezugnahme, bei der es ihm offenbar wichtig war, dass sie seinen Lesern und Leserinnen nicht entgeht. Der Bezugstext fällt aber völlig aus dem Rahmen, denn weder handelt es sich dabei um einen Text der klassischen Moderne noch um einen der Romantik, um die beiden für Hilbig wichtigsten literaturgeschichtlichen Epochen zu nennen, auf die er immer wieder Bezug genommen hat. Nein: Die Gesta Romanorum – auf Deutsch: Die Taten der Römer oder Geschichten von den Römern – stammen aus dem Mittelalter und sind eine Sammlung von mehr als 200 Erzählungen verschiedener Art und Herkunft, die, wahrscheinlich um das Jahr 1300, von einem unbekannten Autor in lateinischer Sprache verfasst bzw. zusammengestellt wurden. Wie zahlreiche Abschriften belegen, war diese Sammlung außerordentlich beliebt, sie kursierte in ganz Europa. Diese Beliebtheit endete auch mit dem Buchdruck nicht, vielmehr wurden die Gesta Romanorum bis ins 17. Jahrhundert vielfach gedruckt. Entsprechend hat die Sammlung zahlreiche Spuren in der europäischen Literatur hinterlassen: Shakespeare hat ihr zum Beispiel stoffliche Anregungen unter anderem für The Merchant of Venice entnommen, und Boccaccio die (später auch von Lessing aufgegriffene) Geschichte von dem Juden Melchisedech und den drei Ringen.
Dass sich aber ein Autor wie Wolfgang Hilbig in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf diese Sammlung bezogen hat, ist überraschend. Wie mag er überhaupt darauf gestoßen sein? Diese Frage wenigstens lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit beantworten: Glasasche ist auf 1973 datiert, und in diesem Jahr erschien – ein wichtiges Ereignis in der deutschen Rezeptionsgeschichte der Gesta Romanorum – im Insel Verlag in Leipzig die erste (angeblich) vollständige Übersetzung dieser Sammlung ins Deutsche, herausgegeben von dem zu diesem Zeitpunkt an der Universität Leipzig tätigen Altphilologen Winfried Trillitzsch. Es liegt also nahe, anzunehmen, dass Hilbig durch das Erscheinen dieser Ausgabe auf die Gesta Romanorum aufmerksam wurde. In jedem Fall muss er damals darin gelesen haben und dabei auf No. 46 gestoßen sein:
„46. Der Laubsammler. Glasasche
Julius erzählt, daß einer im Monat Mai in einen Hain ging, in welchem sieben Bäume standen, die voller Blätter und hübsch anzusehen waren; und er sammelte so viel Laub, daß er nicht alles fortbringen konnte. Da kamen drei starke Männer und führten ihn aus dem Haine hinaus. Als er aber hinaustrat, fiel er in eine tiefe Grube und versank wegen der Größe seiner Last. Ferner erzählt ein Philosoph in seinem Buche von den Tieren: Wenn man bewirken will, daß ein Rabe, der auf einem Baume sein Nest gebaut hat, nie aus seinen Eiern Junge hervorbringen kann, so soll man Glasasche zwischen den Baumstamm und seine Rinde streuen; und solange die Asche dort sein wird, bringt er niemals Junge hervor.“
Ohne jeden Zweifel ist dies die Vorlage von Hilbigs Erzählung. Das zeigt sich schon daran, dass Hilbig einen Teil des (von Trillitzsch stammenden) Titels übernommen hat. Und auch sonst hat er manches aus dem mittelalterlichen Text entlehnt, angefangen von der Zweiteiligkeit seines Aufbaus bis hin zu einzelnen Wörtern und Wendungen. Und da er, wie gesagt, im Untertitel seiner Erzählung auf die Vorlage verwies, muss es ihm wichtig gewesen sein, dass man die beiden Texte in Bezug zueinander setzt. In der Tat ist ein solcher Vergleich aufschlussreich – ja er ist sogar notwendig, will man Hilbigs Erzählung verstehen.
Sieht man sich zuerst die Vorlage an, stellt man schnell fest, dass auch dieser Text Fragen aufwirft: Wer zum Beispiel ist jener Erzähler namens Julius, und wer jener Laubsammler, dem so Merkwürdiges widerfährt? Und was hat die Erzählung im Tierbuch des Philosophen (mit dem Aristoteles oder Plinius der Ältere gemeint sein dürfte) im zweiten Teil mit dem ersten Teil des Textes zu tun? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Sammeln des Laubes und der Empfehlung des Philosophen, Glasasche zu verwenden, um die Ausbreitung einer Rabenpopulation zu verhindern?
Solche Fragen dürfte sich auch Hilbig gestellt haben, als er den Text las, zumal ihm in der Ausgabe Trillitzschs keinerlei Anmerkungen beigegeben sind, die zum Verständnis hätten behilflich sein können. Was Hilbig nicht wissen konnte: Die Rätselhaftigkeit seiner Vorlage hing damit zusammen, dass Trillitzsch den Text nur unvollständig übersetzt hatte. Eigentlich hätte noch ein ganzer Abschnitt folgen müssen, die sogenannte moralisatio, in der die Erzählung nach den Regeln der Allegorese gedeutet wird. Im lateinischen Original lautet diese moralisatio folgendermaßen:
„Carissimi, istud nemus est mundus iste, diversis arboribus delectabilibus, i. e. peccatis mortalibus plantatus. In isto nemore scilicet mundo sunt septem arbores, que significant septem peccata mortalia, ex quibus tantum homo colligit et facit pondus, quod portare non potest nec levare, i. e. de peccato suo non pergere potest nec ad graciam dei pervenire, quam diu in peccato permanet; sed ecce tres viri veniunt, custodes scilicet nemoris, qui ipsum juvant, scilicet mundus, caro, demonia, et ista visibilia, que juvant hominem diversis peccatis et ducunt usque ad exitum nemoris, i. e. usque ad exitum a corpore; sed tunc demergitur in profundum inferni pre magnitudine suorum peccatorum. Item corvus est diabolus, nidus est habitacio in corde per inchoacionem iniquitatis. Per vitrum, quod diversorum colorum reperitur, caro designatur humana, per cinerem mortis memoria, quia vitrum ex cinere fit et in cinerem revertitur. Ponatur ergo mortis memoria inter arborem et corticem i. e. inter animam et corpus. Corpus est quod cortex est, regens animam, et sic diabolus numquam prolem procreabit perverse operationis. Quod nobis concedat etc“
Und in deutscher Übersetzung:
„Ihr Lieben, jener mit verschiedenen schönen Bäumen, das heißt mit den Todsünden bepflanzte Hain ist diese Welt. In jenem Hain, nämlich in der Welt, stehen sieben Bäume, die die sieben Todsünden bedeuten, von denen der Mensch so viel sammelt und ein Gewicht zusammenbringt, das er weder tragen noch verringern kann, das heißt er kann weder von seiner Sünde ablassen noch zur Gnade Gottes gelangen, solange er in Sünde verharrt; aber siehe, drei Männer, nämlich die Wächter des Haines, kommen, die ihm helfen, nämlich die Welt, das Fleisch, das Böse und all jene sichtbaren Dinge, die den Menschen mit verschiedenen Sünden erfreuen und ihn bis zum Ausgang des Haines führen, das heißt bis zum Ende des Lebens; aber dann stürzt er aufgrund der Schwere seiner Sünden in die Tiefe der Hölle hinab. Auch ist der Rabe der Teufel, sein Nest ist die Wohnung im Herzen wegen des Anfangs des Übels. Das Glas steht, weil verschiedene Farben in ihm wahrnehmbar sind, für den Leib des Menschen, die Glasasche für die Erinnerung an den Tod, weil Glas aus Asche hergestellt wird und wieder zu Asche wird. Man streue also den Gedanken an den Tod zwischen den Baum und die Rinde, das heißt zwischen die Seele und den Körper. Der Körper ist die die Seele lenkende Rinde, und so wird der Teufel keine Frucht aus seinem verkehrten Werk hervorbringen. Das gewähre uns etc.“
Man kann dieser moralisatio also entnehmen, wie No. 46 im Mittelalter verstanden wurde: als eine allegorische Darstellung der Sündhaftigkeit des Menschen, die aber auch einen Hinweis darauf enthielt, wie er seine Seele vor dem Teufel retten könnte – indem er sich seine Sterblichkeit vor Augen führte, was in das ohne diese Deutung rätselhaft bleibende Bild von der zwischen Baum und Rinde gestreuten Glasasche gefasst wird. Es ist wahrscheinlich, dass der Text mit dieser Deutung im Mittelalter auch in Predigten Verwendung gefunden hat, gewissermaßen als prägnantes narratives Anschauungsmaterial.
Allerdings konnte Hilbig davon eben nichts wissen. Als Leser der Ausgabe Trillitzschs erfuhr er nichts darüber, allenfalls hätte er der Einleitung des Herausgebers entnehmen können, dass manchen Texten in den Gesta Romanorum früher einmal solche moralisationes beigegeben gewesen waren, die auf „den heutigen Leser“ laut Trillitzsch jedoch „recht ermüdend“ wirkten.
Ohne eine solche Verständnishilfe muss Hilbig der mittelalterliche Text also reichlich dunkel erschienen sein, und vielleicht war es – neben dem für ihn so zentralen Stichwort der Asche – gerade das, was ihn dazu gebracht hat, ihn umzuschreiben und dabei in eine genuin spätmoderne Erzählung zu verwandeln. Denn das hat er getan, und zwar, wie es scheint, schon sehr bald nach der Lektüre von No. 46 – Glasasche ist ja noch in demselben Jahr entstanden, in dem Trillitzschs Übersetzung der Gesta Romanorum erschienen ist. Aber nicht nur aus diesem Grund ist das Ganze ein bemerkenswerter Fall: Dass ein in der DDR lebender, als Heizer arbeitender und nebenbei schreibender Autor in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts einen mittelalterlichen Text umschreibt, dürfte einzigartig sein.
Wie ist Hilbig also bei der Umschrift von No. 46 vorgegangen?
Als erstes ist hervorzuheben, dass er den Text ausgeweitet, seine wenigen, bis zur Sprödigkeit verknappten Sätze zu einem stilistisch reichen, rhythmisch federnden und von expressiven Metaphern und Symbolen durchsetzten Glanzstück spätmoderner Prosa ausgestaltet hat. Im Hinblick auf den Aufbau hat er die vermeintliche Zweiteiligkeit der Vorlage grundsätzlich beibehalten, doch hat er die beiden Teile thematisch und stilistisch stärker voneinander abgesetzt, und vor allem hat er in einem codaartigen dritten Teil versucht, einen Zusammenhang zwischen ihnen herzustellen, wobei er aber eben nicht auf die moralisatio zurückgreifen konnte, sich also selbst etwas ausdenken musste. Dass er überhaupt einen dritten Teil ergänzt hat, zeigt, dass er als der feinfühlige Leser, der er war, die Leerstelle im Text, die aufgrund der fehlenden moralisatio entstanden war, gespürt haben muss und sich nicht mit ihr zufrieden geben wollte.
Zunächst zum ersten, dem Laubsammler gewidmeten Teil (wobei Hilbig dieses Wort nicht aufgegriffen hat): Neben der Veranschaulichung und Verlebendigung dieses Abschnitts, die er unter anderem durch die Hinzufügung wörtlicher Rede und realistischer Details erreicht hat, springt hier vor allem ins Auge, dass er aus den „drei starken Männern“ die „Götter des Waldes“ gemacht hat, und aus der Begegnung des Mannes (der entfernt an Josef K. denken lässt) mit ihnen die letzte Begegnung eines Menschen mit den Göttern. Hilbig erzählt also – und weicht dabei weit von seiner Vorlage ab – vom Ende eines mythischen Zeitalters, in dem die Natur noch von Göttern bevölkert war, die den Menschen nicht unbedingt freundlich zugetan waren. Mit dem Tod des Laubsammlers in der Grube ist dieses Zeitalter aber nun eben beendet, wobei offen bleibt, ob dies zu bedauern sei oder nicht. Des Weiteren fällt auf, dass Hilbig einen zweiten Erzähler eingeführt hat, der eine dezidiert andere Haltung an den Tag legt als der aus der Vorlage übernommene erste Erzähler namens Julius. Man könnte Hilbigs zweiten Erzähler als einen quellenkritischen Vermittler der mittelalterlichen Überlieferung bezeichnen, als eine Instanz, die diese Überlieferung fasziniert, aber skeptisch sichtet und sie in modifizierter Form an die Leserinnen und Leser ihrer eigenen Zeit weitergibt. Das kommt vor allem in der Bemerkung des zweiten Erzählers zum Ausdruck, der erste habe das „bittere Ende“ des Laubsammlers aus Angst vor den Göttern verschwiegen. Das wird nun aber nachgeholt: „denn wie wir der Dinge habhaft werden, glauben wir nicht mehr an ihre Gefahr.“ Hilbigs zweiter Erzähler fürchtet die „Götter des Waldes“ demnach nicht mehr, vielmehr sieht er sie offenbar als Figuren aus einer fernen, versunkenen Epoche an. Entscheidend ist dabei die Formulierung „wie wir der Dinge habhaft werden“ – aus ihr geht hervor, dass Hilbig die epochale Differenz zwischen dem aus seiner Sicht noch einem älteren, mythischen Zeitalter angehörenden mittelalterlichen Text und seiner spätmodernen Umschrift bewusst war.
Liest man den zweiten Teil seiner Erzählung, kann man sich dieser Differenz aber nicht mehr so sicher sein: Hilbig löst sich hier noch weiter von der Vorlage und entwirft eine apokalyptische, zwischen Mittelalter und Spätmoderne, Alchemie und Industrialisierung, Hölle und DDR changierende Szenerie. Die Erzählung gewinnt dabei eine solche Bildkraft, das man sich in ein von Hieronymus Bosch und Werner Tübke gemeinsam gemaltes Gemälde versetzt fühlt. Und die Sprachmacht, die Hilbig entfaltet, wirkt so, als hätten Kafka und der Verfasser der Offenbarung des Johannes Paten gestanden. Die Epochen vermischen sich hier also, Spätmoderne und Mittelalter gehen ineinander über, und es ist kaum mehr möglich, sie auseinander zu halten.
In der Coda, die an die Stelle der fehlenden moralisatio tritt, wird diese Überlagerung der Epochen schließlich explizit thematisiert:
„Der Zusammenhang besteht im Gleichzeitigen, eines weiß nicht des anderen Kommen, doch dieses ist schon dumpf auf den Wegen; der kalte ungesunde Norden – Glasasche; Zeitasche; hysterisches Tohuwabohu der Alchimie, nichts nimmt ein Ende – kann immer noch gerettet werden.“
Nichts könnte weiter entfernt sein von der mittelalterlichen Vorlage als dieser so suggestiv formulierte wie kryptische Schlusssatz, der den Leser, die Leserin gebannt, aber ratlos, mit einer vagen Hoffnung auf Rettung (wovor?) zurücklässt. Wohin ist man bei dieser unheimlichen Begegnung von Mittelalter und Spätmoderne nur geraten?
Im Schlusssatz fällt das Wort „Zeitasche“ ins Auge – ein vieldeutiges, abgründiges Wort, wohl ein Neologismus. In ihm hat Hilbig, so scheint es, die Überlagerung der Epochen, die sich in seiner Erzählung ereignet und aus der sie hervorgegangen ist, auf den Begriff gebracht: „Zeitasche“ – das könnte doch das sein, was übrig bleibt, wenn das Feuer eines Zeitalters heruntergebrannt ist. Mehr als ein halbes Jahrtausend später, am Ende des 20. Jahrhunderts, ist das mittelalterliche Feuer längst erloschen. Hilbigs Erzählung aber zeigt, dass es unter der Asche noch glüht.
Frieder von Ammon, geboren 1973 in München, ist seit 2015 Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Leipzig. Mitherausgaben: "Goethe-Jahrbuch", "Lyrik/Lyrics. Songtexte als Gegenstand der Literaturwissenschaft" (2019). Er lebt in Leipzig.