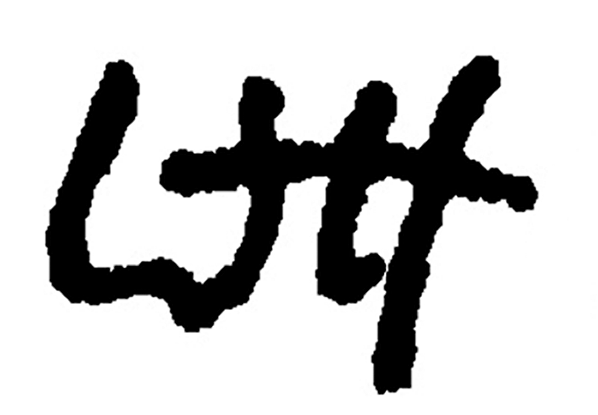Michael Hametner interpretiert Wolfgang Hilbigs Erzählung „Die Flaschen im Keller“ – erster Teil des Lesarten-Projekts der Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft anlässlich des 80. Geburtstags des Dichters
I Die Auswahl von „Die Flaschen im Keller“
Ich kann mich gut daran erinnern, wie Wolfgang Hilbig „DIE FLASCHEN IM KELLER“ gelesen hat. Wann und wo die Lesung stattfand, erinnere ich nicht mehr, aber an die wenig modulierende Stimme kann ich mich erinnern. Sie klang immer ein wenig heiser, vielleicht vom Rauchen. Der Text umfasst in der Werkausgabe nur neun Druckseiten. Entstanden ist er 1987. In diesem Jahr zog Wolfgang Hilbig von Hanau nach Nürnberg, in die Nähe seiner späteren Frau Natascha Wodin, reiste mehrfach in die DDR und seine Erzählung „Die Weiber“ erschien als Buch. Weil es mit dem Trinken so akut war, zog er 1987 die Notbremse und wies sich selbst ein. Möglich, dass mir „Die Flaschen im Keller“ nicht nur durch Hilbigs Lesung so nah gekommen ist, sondern – erst heute von dieser „Notbremse“ wissend – auch als Ruf nach Hilfe.
II Was erzählt wird
Die Geschichte beginnt mit der Beschreibung des von Flaschen gefluteten Kellers als ein wahres Übel. Hilbig schafft mit Worten wie: ergossen, Wogen, Flüssigkeit, Brandung, Meerarm, See die Assoziation einer Flut. Jene findet im Hauskeller unter der Wohnung des erzählenden Ich statt, das sie „die schrillste Stimme meiner schlaflosen Nächte“ nennt. Die Flaschen sind nicht einfach nur vergessene Flaschen, auch nicht abgestellt für baldige Entsorgung, sie stellen eine uneingeschränkte, unentrinnbare Macht dar. Ein Albtraum für den Erzähler, weil die Anwesenheit der Flaschen der Hauptgrund seines Daseins geworden war. In ihm habe sich Angst ausgebreitet, demnächst den Keller ausräumen zu müssen. Er sei nämlich eines Tages dafür die einzige gebrauchstüchtige männliche Person im Haus. Dies ist der Albtraum, der ihn jetzt, noch Kind, bereits verfolgt. Danach klärt uns der Erzähler über die Vorgeschichte der Flaschen auf. Sie galten einer großangelegten Mostproduktion. Eine unglaubliche Obstschwemme im nahen Garten war dafür Ursache. Wegen der drohenden Mostproduktion versuchte er, sich im Haus unsichtbar zu machen und war ständig zum Verlassen der häuslichen Zustände bereit. Aber so einfach ging das nicht. Der angeschaffte weiße Aluminiumbehälter, die Mostwanne, nehme ich als Unkundiger an, funktionierte nicht, nie, in keinem Herbst konnte sie die Obstinvasion bewältigen. Immer wieder musste der Behälter in seine Einzelteile zerlegt und wieder anders zusammengesetzt werden. Half aber nicht, auf dem Hof stauten sich Handwagen, Wannen, Wäschekörbe mit Äpfeln und Birnen, die verkocht werden wollten, was aber nicht ging. Alles wieder von vorn mit noch mehr Äpfeln und noch mehr Birnen. Das Ganze ist ein bedrohlicher Vorgang, wie im Märchen vom „Süßen Brei“, wo die gierige Mutter das „Töpfchen steh!“ vergessen hat. Nächtliche Versuche des Erzählers, den Haustieren den süßen Brei zum Fressen zuzuleiten, scheiterten an der schieren Menge, die bei den Tieren zu schwerstem Durchfall führte.
Was sie gerufen haben, dessen werden sie nicht mehr Herr: Das Obst erweist sich als unbesiegbar. Der Erzähler zeigt uns die Szene im Mondschein, wenn die blaue Essigflut den Hof in ein höllisches Areal verwandelt. Auf diesem Höhepunkt der Macht der Obstsäfte steigert der Erzähler das Ich in ein Wir. Plötzlich kommt über diesen Vorgang das Schicksal aller Besiegten und am Boden liegenden Individuen zur Sprache. Und nun, als sei die Geschichte nicht schon an ihrem Ende angekommen, stellt er auch noch die Sinnlosigkeit des Tuns fest, denn es sind über die Jahre nur wenige Flaschen gefüllt worden und es gab niemanden, der sie austrinken wollte. Was kurioserweise den Ich-Erzähler zur Solidarität herausfordert, zunächst mit den vollen Flaschen oben auf dem Regal, dann mit den leeren Flaschen unten vor den Regalen. Er fängt an, die vollen Flaschen zu leeren und schafft damit am Boden neue Randgruppen. Es scheint der Schuldkomplex den unteren leeren Flaschen gegenüber zu sein, der ihn mit dem Fluch zum Trinken belegt. Als ebenfalls bereits traumatisierte Leser werden wir Zeuge, wie Trinken zur Sucht wird, gegen die nur Trinken hilft. Und wie bei Süchtigen üblich, kann Nachschub nur durch Kleinkriminalität besorgt werden. Das Ich weiß von den Flaschen im Nachtschränkchen der Mutter. Zwar mit den widerwärtigsten Inhalten: Liköre oder übersüßte Rotweine. Es schleicht sich nachts auf allen vieren am Bettgestell vorbei zum Schrank. Immer ängstlich unterbrochen, wenn das Schnarchen der Mutter aussetzt. Aber es gelingt.
Der Zwang zum Trinken zeigt sich als Eintritt in die Selbstzerstörung. Erbrechen der ungeheuerlichen Mengen ginge schon gar nicht mehr, heißt es. Und was sollte erbrochen werden? Der Erzähler will, dass er den Schlaf erbricht, der keine Befriedigung mehr verschafft und der den am Boden Liegenden nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Er vermag nur noch halb schlafend „dem Heulen der Flaschen im Keller“ zu lauschen. – Welch eine Folter!
III Das Thema Alkohol – eine Selbsterklärung?
Welch eine Prosa! Ein Höllenritt durch einen Keller voller Flaschen, entstanden durch eigentlich harmlose Mostherstellung, die aus den Fugen gerät, das erzählende Subjekt aus seiner Kindheit reißt und zum Objekt einer fremden Macht werden lässt, um es in die Arme des Alkohols zu treiben. Da viele der Texte Hilbigs autobiografisch grundiert sind, manchmal mehr als das, könnte dieser erste Schlüssel passen, um den Text aufzuschließen: Hilbig schreibt davon, wie er dem Teufel Alkohol in die Arme fiel. Was in diesen ersten Jahren in der Bundesrepublik der Fall war, wie wir als Leser aus seinem Roman „Das Provisorium“ wissen. Die Schreibkrise im „Dazwischen“ des geteilten Landes versuchte Hilbig mit Alkohol zu lösen. Aber eigentlich ist es die viel zu plumpe Deutung der Erzählung „Die Flaschen im Keller“. Sie darf aber ausgesprochen werden, denn 1987 – im Jahr als er sie schrieb – wies er sich selbst in eine Trinkerheilanstalt nahe München ein. Andererseits führen nicht alle Deutungswege dieser ästhetisch so präzise komponierten Erzählung in die Anstalt. Das wäre plump, das wäre billig. Hilbig erklärte mehrfach, nur getrunken zu haben, wenn er nicht schreiben konnte, und zweitens war er als Dichter auch in seiner Prosa viel zu artifiziell, um sich mit der Mostproduktion im Haus der Mutter ein Alibi für seinen Alkoholzwang zu konstruieren. Und drittens glaube ich, schon in Franz Kafkas Texten, in denen eine anonyme Macht sich ihre Opfer greift und zur Schlachtbank führt, viel mehr Humor zu lesen, als noch in Zeiten bestehender Diktaturen darin gelesen wurde. Vielleicht sollte man von schwarzem Humor sprechen, aber Kafkas Sinn für Absurdes besaß viel mehr Humor, als ihm die Literaturwissenschaft gewöhnlich zugesteht. Und wie ist das bei Wolfgang Hilbig? Nicht anders. Man kann darüber schmunzeln, wie über die Jahre aus geleerten und ungenutzten Mostflaschen im Keller eine unkontrollierbare Invasion wächst, die dem, der weiß, dass er eines Tages zur Beräumung aufgerufen wird, Angst macht. Wer sagt einem übrigens, ob der, der dies eines Tages zu leisten hat, nicht maßlos übertreibt? Wegen seiner Angst. Ob sie sich nicht im Albtraum meldet als schier unbesiegbare Macht? Träume vermögen Ängste in Dämonen verwandeln.
IV Romantik als Abenteuerwelt zwischen Realität und Fantasie
Nach Hilbigs eigenem Bekenntnis zu seiner Vorliebe für artifizielle Literatur könnte man „Die Flaschen im Keller“ auch als sein romantisches Manifest lesen. Zur Romantik hat er sich bei Fragen nach seinen Traditionen bekannt. Das in seiner Literatur so verbreitete Motiv der Nacht erklärt sich biografisch aus dem nächtlichen Schreiben, erst im Heizungskeller in Meuselwitz, später am Schreibtisch in Leipzig oder Berlin. Es erklärt sich aber auch aus der ihm nahestehenden Literatur der Romantik, wo es ein sehr verbreitetes Motiv war. Und noch etwas findet sich in der Romantik ganz vorn: mit ihrem dem Gefühl so schmeichelnden Eskapismus war sie eine Hochzeit der Märchen. Also führt die Motivkette von Hilbigs Erzählung ohne große Kurven und Schlingen zum Märchen „Der süße Brei“ in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Hier stimmt selbst der Ausgangspunkt mit Hilbigs Erzählung überein, denn in beiden Texten lebt ein Kind allein mit seiner Mutter. Konnte daraus nicht auch das Verschlingende, Verführende, das Angsterregende und Unentrinnbare erwachsen, was Hilbig in seiner Erzählung beispielsweise in der nächtlichen Szene festhält, wenn das Ich auf allen vieren zum Nachtschrank der Mutter kriecht, um ihr den widerlichen Wein zu stehlen. Die Angst vor der Mutter, mit der er im realen Leben – wie er sinngemäß sagte – bis in seine dreißiger Jahre in platonischer Blutschande zusammenlebte.
Immer wieder Träume und Albträume, Illusionen und Meldungen des Unterbewusstseins, die in der romantischen Literatur ein ästhetisches Zentrum bildeten. Sich wegträumen von der industriell-vorkapitalistischen Welt. Das hätte Hilbig für seine Literatur so explizit gesellschaftskritisch niemals formuliert, aber vielleicht wollte er sich absetzen in eine wilde Welt aus nächtlichen Abenteuern. Hilbig hatte mit seinem ersten, nicht beendeten Romanprojekt vor, Novalis, dem Vater der Blauen Blume, zu folgen. Macht er sich in „Die Flaschen im Keller“ nicht Novalis' „qualitative Potenzierung“ durch die romantische Literatur zu eigen, wenn er schreibend dem Bekannten die Würde des Unbekannten gibt und dem Gewöhnlichen das geheimnisvolle Ansehen? Auf der Suche nach einer Lesart sind nicht nur Wege zu Kafkas absurdem Humor zu gehen, sondern auch zum Vize-König der Romantik – nach Novalis, dem König – E. T. A Hoffmann. Wie gut passt Hilbigs Erzählung neben E. T. A. Hoffmanns „Der goldene Topf“? Anselmus, der unglückliche Held, erlebt nicht nur, wie die Dämonen unter Alkoholeinfluss zu ihm zurückkehren. Näher noch ist ihm und Hilbigs Ich-Erzähler die Existenz einer Welt jenseits des Sicht- und Fassbaren. Zwischen Fantasie und Realität bewegt sich Hilbigs Prosa immerfort, oft mit surrealen Erfindungen, wie hier die Überflutung des Kellers mit Flaschen. In jeder Flasche steckt ein Geist, der den Erzähler foltern will. Bei E. T. A. Hoffmann gerät Anselmus nach einer Ohnmacht selbst in eine Kristallflasche. Hilbigs Ich-Erzähler gerät als Trinker an, bildlich sogar ebenfalls in die Flasche. In diesem Moment bilden nur noch Finsternis, Schweiß und Durst die traurige Basis seines Daseins. Entstanden ist die hohe ästhetische Anverwandlung eines Erzählmotivs, das der Autor vielleicht aus seinem Leben selbst genommen hat, auf neun Seiten Literatur.
V Mögliche Missverständnisse bei der Suche nach Aktualität
Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer, ein bekennender Hilbig-Jünger, erinnerte in einem kleinen Zeitungsbeitrag an eine Lesung dieser Erzählung im September 2015 im Literaturhaus Leipzig. Da fragte eine Frau aus dem Publikum doch tatsächlich, ob man das Bild von der Flut im Keller nicht heute auf die Flüchtlingsströme, metaphorisch und so weiter ... Meyer weist diese aktualisierende Deutung entschieden zurück: „Nein! Können wir nicht und wollen wir nicht! Einen Abend bitte mal nur die Poesie! Nicht doch wieder etwas irgendwo reininterpretieren, einmal nur innehalten, wenn alle Menschen Hilbig oder andere Dichter lesen würden, dann wäre die Welt sicher nicht so, wie sie ist.“
Hilbigs Dichtung, ob in Prosa oder Gedicht, war immer Ich-Arbeit, nicht Arbeit an der Gesellschaft. Hilbig war als Dichter nicht auf eine Moral fixiert, sondern auf die Form. Er stellte seine Literatur außerhalb der Gesellschaft, weil er nur so etwas für sich selbst herausfinden konnte. Darin lag der Grund seines Schreibens. Vielleicht suchte er in „Die Flaschen im Keller“ den Punkt, von dem ab er verwahrlosen könnte. Verwahrlosen ist ein ernstes Hilbig-Wort. 2003 will Günter Gaus in seiner Fernsehsendung „Zur Person“ von ihm wissen, welchen Luxus er sich jetzt, da er den Büchner-Preis erhalten habe, gern leisten würde, teuren Wein zum Beispiel, antwortet Hilbig: „Ich merke es nicht, wenn der Wein nicht gut ist. Da ist mein Geschmack zu verdorben.“
geb. 1950 in Rostock, Journalist, Literaturkritiker und Hörbuchsprecher, lebt in Leipzig. Über zwanzig Jahre leitender Literaturredakteur des MDR-Hörfunks, rief er 1995 den MDR-Literaturwettbewerb ins Leben und betreute ihn bis zum 20. Jahrgang. Er trat als Herausgeber von Kurzgeschichten-Anthologien und anderer Sammlungen und in jüngster Zeit als Autor von Büchern über Bildende Künstler in Erscheinung. Michael Hametner ist seit 2012 Mitglied der Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft, gestaltet ihr Programm mit und setzt sich für ein "Wolfgang-Hilbig-Literaturstipendium“ ein.